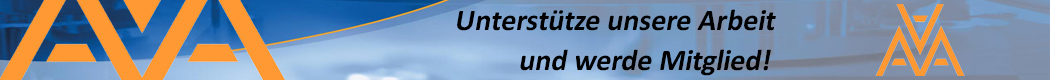Toni,
für mich ist gerade der erzielte Klangcharakter durch Klirr, was SE Konzepte so liebenswürdig macht und daher steht das für mich in den Vordergrund.
Wie immer, Geschmackssache ![]()
![]()
![]()
Toni,
für mich ist gerade der erzielte Klangcharakter durch Klirr, was SE Konzepte so liebenswürdig macht und daher steht das für mich in den Vordergrund.
Wie immer, Geschmackssache ![]()
![]()
![]()
das mit dem Wirkungsgrad ist halt immer auch ne Sache wie gemessen wird 🤔
Meistens im Bereich bei 1 kHz. Desweiteren wird oft eine Angabe bei Nennimpedanz gemacht z.B. 8 Ohm, was meistens nochmals bis zu 20% drunter liegen kann. Diese Angabe der Empfindlichkeit ist sowieso recht wage spezifiziert, alleine schon die Tatsache, dass es z.B. 95dB / 1 Watt / 1 Meter. Eine Leistungsangabe ohne Impedanzspezifikationen ist nicht brauchbar. Wenn schon müsste es 95dB SPL / 1 Meter bei 2,83V sein und eine Angabe in welcher Bandweite, z.B. 100Hz - 20kHz.
Wie so einiges in der HiFi Branche haben sich Sachen eingebürgert, die technisch inkorrekt sind.
Das kritisiere ich schon einigen Jahren.
Wenn es um Schaltnetzteile geht benutze ich nur noch solche die für medizinische Zwecke spezifiziert sind. Desweiteren nur noch TRACO POWER.
Nein , geht nicht. 2 Stifte sind im Durchmesser stärker. Passt nicht falsch herum, auch nicht mit Gewalt.
Ist mir aber auch schon passiert ...
Man kann eine Röhre in einer UX4 Fassung falsch stecken? Mit nem Hammer?
Ja, kann man und einen Hammer braucht man dazu nicht ![]()
Wenn man das Pech hat, Anode mit Kathode über den
Heizfaden zu verbinden, geht die Post ab.
Ja, kann sein ![]()
War defekt. Aber nur ein paar Widerstände und Kondensatoren.
Ein oft vorkommender Fehler bei vielen dieser Schnäppchen. Üblicherweise sind die Widerstände was der Leistungsverlust anbetrifft, nicht korrekt dimensioniert. Ähnliches trifft auf die Kondensatoren zu. Da ist oft die Spannungsfestigkeit nicht ausreichend.
Alles anzeigenMeine Fragen.
1. Wie kann ich die Ausgangstrafos messen ob sie ok sind.
2. Würde es sinn machen das Metall + Röhren als Basis für einen Neuaufbau zu nehmen?
3. 2A3 oder 300B? Sind die untereinander mal so umzustecken?
4. Welche Schaltung unter beibehaltung der Röhren. Uchida, Loftin White etc.
5. Kennt jemand diesen Verstärker. Das Web sagt 2A3 SE Woodsound LBT-2A3.
6. Diese Mini Trimmpotis unter der 2A3 sollen doch nicht etwas die Symmetrierung für die Heizung der 2A3 sein?
Im Allgemeinen, brauchst Du Messgeräte, mindestens aber ein Multimeter um Spannungen und Widerstände messen zu können. Außerdem Lötkolben oder Station um hier und da Teile oder Kabel zu trennen und neu verlöten. Letztendlich auch sehr viel Vorsicht weil man es mit hohen Spannungen zu tun hat.
Vor jeglicher Messung von Widerständen muss überprüft werden ob keine Spannung mehr vom Netzteil geliefert wird. Dazu Gerät ausschalten und mehere Minuten warten bis die Ladeelkos entladen sind und auch messen.
Zu deinen Fragen:
Dem Bild nach sind die Kathodenwiderstände heiß geworden. Das kann auf defekte 2A3 hindeuten.
Wie bei vielen günstigen China-Produkten, scheinen mir hier und da Bauteile nicht korrekt diemensioniert sein. Z.B. der Kathodenkondensator der 2A3. Der ist mit 100V angegeben, 160V oder höher würde sicherer sein.
Die Melz 6SL7 haben bereits über 30 Stunden Einspielzeit hinter sich und daher habe ich eine erste Messung vom Klirr gewagt. Beide Röhren weisen weiterhin ein stärkeres Rauschen auf, wenn man das Ohr nahe an den Coax meiner Sonus Natura Extremi hält, allerdings ist so ein Knistern, das man auch hörte nicht mehr vorhanden. So ein Effekt hatte ich bei den Linlai 6SL7 auch und wie bei den Melz ist das nach einer längeren Benutzung verschwunden. Was allerdings geblieben ist, ist ein höher wahrnehmbares Brummen, allerdings nicht am Hörplatz, sondern nur wenn man das Ohr nahe an die Lautsprecher hält. Das ist bei de Linlai 6SL7 nicht verschwunden und ich gehe davon aus, dass es bei meinen Paar Melz 6SL7 auch nicht besser wird.
Gegenüber den SOVTEK 6SL7 zeigt sich mit beiden Melz 6SL7 ein höherer Klirr, der bei 0,51% bzw. 0,48% liegt. Der K3 Klirr ist einiges geringer und K2 etwas höher.
Leider ist ein etwas höherer Rauschteppich ab 1 kHz zu sehen, was allerdings bei mir an der Tagesform vom Strom liegt. Eine Messung mit der SOVTEK 6SL7 zeigte sich ähnlich.
Das hörbare höhere Brummen / Rauschen ist am Pegel des Rauschteppiches unterhalb von 1 Khz, insbesonders < 500Hz gut zu erkennen. Das sieht ähnlich aus wie mit den Linlai 6SL7, bei denen ich auch ein stärkeres Brummgeräusch am Coax wahrnehmen kann.
Fazit aus allen Messungen und Hörproben ist für mich, dass es zwar Unterschiede geben kann, wie z.B. der Klirr der im Bereich von ca. 0,3% - 0,9% je nach Vorstufenröhre liegen kann, aber es nicht unbedingt eine Garantie dafür gibt, dass hochgepriesene Produkte auch das besser Ergebnis liefern.
Aus meinen gemachten Erfahrungen, und das nicht nur mit meiner SET 211, kann ich nur sagen, dass die SOVTEK 6SL7, sowohl hörbar, aber auch messtechnsich eine gleichbleibende Serienkonstanz aufweist und somit bei mir weiterhin als "Referenz" bleibt ![]()
Der Kunde, der mir letztens einige seiner 6SL7 Röhren für Testzwecke ausgeliehen hat, benutzt noch ein weiteres Paar für seine Sonus Natura Custom SET 211, nämlich von MELZ.
Tube Amp Doctor schreibt dazu:
"Das Fabrikat MELZ gilt als die absolut hochwertigste 6SL7GT Variante aus russischer Fertigung. Qualitativ mit NOS RCA 6SL7GT oder VT229 aus USA vegleichbar; nicht wenige Anwender bewerten die MELZ sogar als überlegen...."
Da mein Kunde mit den MELZ 6SL7 sehr zufrieden ist, sie mir aber für meine Evaluierung nicht mitschickte, entschied ich mich aufgrund seiner Empfehlung ein Paar bei TAD zu kaufen.
Sie spielen sich bei mir gerade ein, aber für eine erste klangliche Evaluierung nach ca. 20 Stunden Einspielzeit reicht es bereits schon:
Gegenüber meiner Referenz - klanglich, wie auch messtechnisch - empfinde ich sie lebendiger und dynamischer als die SOVTEK 6SL7GT. Stimmen und Instrumente werden akzentuierter hervorgehoben und die raumliche Wiedergabe, ist breiter und tiefer, was ein Orchester etwas mehr Größe verleiht.
Leider ist es bei mir so, dass beide MELZ ein hörbares Rauschen gegenüber den SOVTEK aufweisen. Das hört man an den Coax der Sonus Natura Extremi, wenn man das Ohr nahe dran hält. So etwas hatte ich am Anfang mit den LINLAI 6SL7 auch und legte sich über die Zeit. Ähnliche Erfahrungen machte ich mit den JJ Electronic 6SL7.
Nach Rücksprache mit meinen Kunden, der sich zwei Paar MELZ 6SL7 zugelegt hat, konnte er das bei sich nicht feststellen.
Wie dem auch sei, die MELZ 6SL7 gefällt mir gut und ich hoffe das leichte Rauschen gibt sich über die Zeit ...
Wenn dem so ist, stelle ich Vergleichsmessungen zur SOVTEK 6SL7GT hier ein, so wie ich es mit den anderen 6SL7 getan habe ![]()
Mit den PSVANE UK-6SN7 und den E-6SN7 Linlai E-Series kommt es egal in welcher Kombination immer zu einem starken Rauschen aus den Lautsprechern.
Diese Erfahrung habe ich bei der Entwicklung meiner Sonus Natura Custom SET 211 auch gemacht, allerdings mit 6SL7 Typen.
Die beste Serienkonstanz ergaben die SOVTEK 6SL7, bei den keine dieses Verhalten aufwies. Die Linlai 6SL7 und die JJ Electronic 6SL7 rauschten am Anfang recht deutlich. Das hat sich bei beiden nach einigen Stunden Einspielzeit gegeben.
Gerade mache ich das auch mit ein Paar MELZ 6SL7 durch, von denen Tube Amp Doctor schreibt:
"Das Fabrikat MELZ gilt als die absolut hochwertigste 6SL7GT Variante aus russischer Fertigung. Qualitativ mit NOS RCA 6SL7GT oder VT229 aus USA vegleichbar; nicht wenige Anwender bewerten die MELZ sogar als überlegen...."
Auch hier hoffe ich, dass sich das über die Zeit gibt ![]()
Ausserdem benötige ich auch die 7-Pin Variante, so fallen (zum Glück) auch diese sauteuren Telefunken raus...
Ist zwar OFF TOPIC, aber bei meiner Sonus Natura Lumina entschied ich mich für die Shuguang EL156 als Oktal-Variante. Laut einen ELEKTOR Bericht ist diese Röhre identisch mit der TELEFUNKEN EL156, da Shuguang die original Produktionsmaschinen aus Ulm erwarb.
Ich konnte messtechnisch keinen Unterschied feststellen, die Daten der Shuguang stimmten bei allen EL156 die ich einsetze sehr genau mit den Datenblättern überein.
Leider werden die Oktal-Versionen der EL156 wirklich rar und ich empfehle für Ersatz zu sorgen.
Durch die Wahl der Oktalfassung bin ich zum Glück flexibel um andere Typen von Röhren einzusetzen und ich bin dabei über eine Alternative nachzudenken ...
Und die 2A3...ist eine 2A3 geworden mit purer Emotion, soweit ich das bei mir in den ersten 2 Stunden sagen kann.
Das freut mich zu lesen und bin gespannt auf weitere Eindrücke ![]()
Ganz nach dem Titel von diesen Thread lasse ich ihn wieder aufleben, denn ein Kunde von mir schickte mir einiges an Material zum Probehören und Testen.
Mein Kunde besitzt schon seit längeren die SET 211 Endstufe von mir und hat selbst einiges an Tube-Rolling ausprobiert. Unter Anderen die Linlai E-211 Endröhre ( Triode ), Linlai 211 DG, aber auch einige 6SL7 Treiberröhren von Tung-Sol NOS, TAD Premium, BTB S4A, Linlai und natürlich die von mir bevorzugte Sovtek.
All diese Röhren habe ich letztes Wochenende bekommen und heute habe ich den ganzen Vormittag damit verbracht mit den unterschiedlichen Kombinationen zu hören und anschliessend einige Messreihen durchzuführen.
Wie immer bei solchen Vergleichen, muss dafür gesorgt werden, dass das System eingepegelt wird und das habe ich auch getan. Dabei dient die Sovtek 6SL7GT und die Shuguang 211 Triode bei mir als Referenz, denn mit diesen Röhren habe ich meine Arbeitspunkte eingemessen.
Unter dieser Vorrausetzung habe ich folgende Ausgangspegel bei 6 Ohm Last gemessen und dafür habe ich eine Messreihe mit der Shuguang 211 Triode gemacht und eine weitere mit der gleichen Treiberstufensektion mit der Linlai E-211 Triode.
In beiden Messreihen, fällt die Linlai 6SL7 etwas aus der Reihe, denn wie schon bei meiner SET 2A3, liefert mit dieser Doppel-Triode die SET 211 Endstufe einen gerigeren Ausgangspegel, der je nach 211 Triode zwischen -3,0dB - -2,5dB liegt.
Alle anderen Treiberröhren geben sich recht konsistent im Ausgangspegel, liegen aber bereits im Wahrnehmungsbereich von 0,5dB.
Ich kann es nur einmal mehr sagen, die Tabelle zeigt wie wichtig es ist, das System einzupegeln, denn nur dann kann man subjektiv eventuelle Unterschiede ausmachen.
Nach den zeitaufwendigen Einpegeln, man muss ja jedes mal warten bis die Röhren die Betreibstemperatur erreichen, aber auch wichtig, dass sie abkühlen bevor man sie tauscht, habe ich mich an das Probe-Hören gemacht.
Das ist natürlcih eine rein subjektive Sache und wer mich kennt weiß, es gibt bei mir nicht "BESSER" oder "SCHLECHTER" sondern von mir folgende Einstufung:
+ Gefällt besser
0 Gefällt
- Gefällt weniger
Zusammengefasst bin ich nach der Hörprobe auf folgende Beurteilung gekommen:
Shuguang 211 + Sovtek 6SL7 / Note +
Hochton detalliert aber nicht nervig, Bass tief, rund, Stimmen sehr gefällig und realistisch, räumlich breit und tief. Insgesamt sehr gefällige Kombination.
Linlai 211 + Sovtek 6SL7 / Note 0
Insgesamt etwas frischer und dynamischer als die Shuguang 211, räumlich weniger breit. Insgesamt gefällig.
Shuguang 211 + Linlai 6SL7 / Note -
Hochton detalliert, spritzig, Bass weniger tief aber konturiert, Stimmen gefällig, räumlich etwas eng. Insgesamt Detail verliebt.
Linlai 211 + Linlai 6SL7 / Note -
Insgesamt etwas frischer und dynamischer als die Shuguang 211, räumlich etwas breiter, Stimmen weniger körperhaft. Insgesamt etwas dünn im Grundton.
Shuguang 211 + TAD Premium 6SL7 / Note +
Hochton detalliert, nicht nervig, Bass tief und rund, Stimmen sehr gefällig, räumlich gute Breite und Tiefe. Insgesamt sehr natürlich.
Linlai 211 + TAD Premium 6SL7 / Note 0
Insgesamt etwas frischer und dynamischer als die Shuguang 211, räumlich weniger breit.
Insgesamt gefällig.
Shuguang 211 + BTB S4A 6SL7 / Note 0
Hochton detalliert, spritzig, Bass weniger tief aber präzise, Stimmen realistisch, räumlich etwas eng. Insgesamt detailreich ( BTB sieht aus wie eine JJ Electronic, baugleich ? ?
Linlai 211 + BTB S4A 6SL7 / Note 0
Insgesamt etwas frischer und dynamischer als die Shuguang 211, Grundton etwas weniger körperhaft, räumlich gute Tiefe und Breite. Insgesamt sehr detailreich ( BTB sieht aus wie eine JJ Electronic, baugleich ? )
Shuguang 211 + Tung-Sol NOS 6SL7 / Note 0
Hochton seidig, warm, Bass tief und rund, Stimmen natürlich, räumlich gute Breite und Tiefe. Insgesamt etwas für das gechillte Hören.
Linlai 211 + TAD Premium 6SL7 / Note +
Insgesamt etwas frischer und dynamischer als die Shuguang 211, Bass tief, rund, , Stimmen sehr gefällig, räumlich weniger breit. Insgesamt sehr gefällig und ähnlich der Sovtek + Shuguang 211 Kombination.
Wie gesagt, dass sind meine Eindrücke und müssen nicht mit deren anderer Hörer übereinstimmen.
Etwas anders sieht es bei der technischen Beurteilung aus, die ich im Wesentlichen auf zwei Messreihen bestehen, Frequenzgangmessung mit meiner Treiberreferenz ( Sovtek 6SL7GT ) und Spektralanalyzen bei 1 Khz / 2W / 6Ohm.
Die Klirr-Messung der einzelnen Kombinationen sieht wie folgt aus.
Auch hier gut zu erkennen, dass die Linlai 6SL7 eher als Aureißer zu betrachten ist und wie schon beim Einpegel, liefert die Sovtek 6SL7 ein sehr gleich bleibendes Bild mit beiden 211 Endröhren.
Die dazugehörigen 211 + Sovtek 6SL7 Kombinationen sehen im Detail wie folgt aus.
Auffällig bei der Linlai E-211 + Sovtek ist, dass sie höheren Klirranteil ab 6kHz besitzt.
Sehr interessant ist die Kombination beider 211 Trioden mit der Linlai 6SL7.
Zwei Sachen sind auffällig, auch hier sind mehr höhere Klirranteile ab 10kHz mit der Linlai E-211 zu erkennen, aber etwas unvorteilhaft ist in beiden Fällen der höhere Rauschteppich unterhalb von 300Hz. Das kann man auch hören, wenn man das Ohr nahe an die Tieftöner hält, denn man vernimmt ein etwas lauteres Brummen / Geräusch mit den Linlai 6SL7.
Durchgängig kann ich außerdem von den anderen Messungen sagen, dass die Linlai E-211 höhere Klirrwerte mit jeder Treiber-Röhre ab ca. 6 - 10kHz liefert.
Da ich die Sovtek 6SL7 als Standard für meine SET 211 benutze, habe ich zu guter letzt noch eine Frequenzgangmessung bei ca. 8W / 6 Ohm mit beiden 211 Trioden durchgeführt.
Beide Kurven sind nahezu identisch, sie unterscheiden sich bei 1kHz um gerade mal 0,1dB und die Linlai E-211 vermag unterhalb von 20Hz etwas mehr Pegel zu liefern.
Zusammnefassend kann ich sagen, dass ich beim Hören, aber auch Messen, geringe Unterschiede vernhemen konnte, mit Ausnahme der Linlai 6SL7. Interessant finde ich, dass die Shuguang 211 sich sehr wacker hält und das obwohl sie schon ein paar Jahre auf den Buckel hat. Desweiteren zeigt sich, dass nicht umbedingt das teuerste das Gefälligste sein muss.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Kunden bedanken, der diesen Vergleich möglich machte ![]()
Toni31 ,
danke für die Messungen und um ehrlich zu sein, wäre mir die erzielte Verbesserung nicht der Aufwand wert. Auch, dass bei 1W und 10W unterschiedliche Implementierungen zu Verbesserungen führen ( 1W CFB(2) und 10W CFB(1) ). Das heißt, man muss sich für eine Option entscheiden. Nimmt man das bei 1W CFB(2) würde das bedeuten, dass bei 10W diese Beschaltung nichts bringt.
eine spezielle Art von Kofferradio= Kofferquäke
Gibt bei Thomann einige davon ![]()
Wie schaut es mit der Quad ESL63 aus
Soweit ich weiß wurde die auch im Studio verwendet
Tonstudios benutzen zum Teil auch HiFi Lautsprecher um z.B. das Material mit gängigen Boxen abzuhören, nach dem Motto, schaun wir mal wie sich das über "normale" Speaker anhört.
Beispielsweise benutzt das "Abbey Road Studio" die B&W 800er Serie um zu prüfen wie deren Abmischung sich anhört, aber diese Lautsprecher erfüllen viele der Kriterien der SSF-01 nicht.
Wenn ich mir viele der Studiolautsprecher anschaue, würde ich sagen, dass die allermeisten die Empfehlungen nicht erfüllen.
Die Frage, die sich stellt, 'Kann sich ein Hersteller für Studio Monitore überhaupt einen Ausrutscher leisten?'
Eigentlich nicht wenn man sich die Empfehlungen des Verbands Deutscher Tonmeister ( VDT ) anschaut. Diese haben im Suround Sound Forum ( SSF ) Anforderungen an Abhörlautsprecher definiert, wie z.B. Linearität im Bereich von 40 - 16.000Hz, Bündelungsmaß ( Abstrahlcharakteristik ), Pegelfestigkeit und maximaler Klirr bei 96dB SPL < 100Hz und > 100Hz.
Ich habe eine Zeitlang ein Studiomonitor im Programm gehabt, Sonus Natura Monitor, der diese Empfehlungen erfüllt hat.
Ich kenne nur zwei Firmen, die die SSF-01 Anforderungen mit Messungen publizieren, und das wäre Gaithein und Neumann.
Übrigens, die Empfindlichkeit ( dB SPL / W / 1m ) spielt im SSF-01 keine Rolle ![]()
Der Herr wird vielleicht nicht geschätzt , technisch ist das aber absolut korrekt !
Im Prinzip hat er sich Mühe gegeben, doch technisch ist das nicht absolut richtig.
Was stimmt, dynamische Lautsprecher haben einen recht schlechten Wirkungsgrad und bei üblichen HiFi-Lautsprechern liegt dieser bei 0,2 - 2%.
Auch wichtig, oft wird in Zeitschriften, aber auch in vielen Foren, über den Wirkungsgrad gesprochen und gemeint ist aber die Empfindlichkeit ( dB SPL / 1W / 1 Meter ). Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die allerdings im Zusammenhang stehen.
Um sich ein korrektes Bild über die Zusammenhänge zu machen, greife ich gerne auf Sengpielaudio zurück ![]()
Im Prinzip hat er ja Recht. Die Angaben sind oft "geschönt".
Das Problem liegt darin, dass die Empfindlichkeit in SPL dB / W / 1m angegeben werden. Zum Einen wird "geschönt" indem z.B. die Empfindlichkeit bei Impedanzmaxima berechnet wird und sich so vorteilhaft bezüglich Leistungsverbrauch zeigt ( U*U / R ) und zum Anderen in Frequenzbereichen die irrelevant sind, z.B. Mittel- oder Hochton.
Es gibt leider keine Norm für diese Angaben. Sinnvoll wäre z.B. das im Bereich von 50 - 200Hz zu definieren, da dort die höchsten Pegel in Musik liegen und SPL dB bei 2,83V, unabhängig von der Leistung.
Ein Qualitätskriterium ist diese Art der Rückkopplung aber nicht - zumindest aber ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
Ganz nach meinen Geschmack: "Keep it Simple"
Absolut richtig, wenn man mit CFB arbeitet, sollte wie bei jeder Gegenkopplung, der abgeriffene IST-Wert diesen Zustand bestmöglich darstellen, weshalb die Qualität der Wicklung wie Du sagst, auch entsprechend gut ausgelegt sein muss.