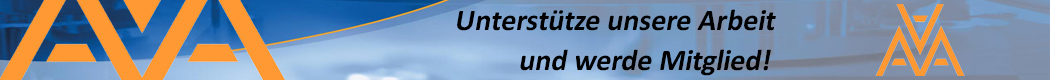Ich bin ja nicht unbedingt der HiFi-Händler Typ.
Toll an Musik im Raum in Essen war immer die Werkstatt, in der tatkräftig und mit ganz viel Sachverstand geholfen werden konnte. Nichts gegen Kuchen, aber mir gefiel der Laden früher besser.
Weil man aber nach vorne blicken muss, möchte ich hier kurz von meiner Entdeckung der Woche berichten. Es ist "Der Claus", aka CBA, in seinem Laden in Taunusstein, nördlich von Wiesbaden.
Das Wichtigste vorweg: Claus ist ein super Typ. Als ich letzten Dienstag gegen 11:00 auf der Durchreise nach Dierdorf zum Caterham-Händler in Taunusstein aufschlug, war mir noch nicht klar, dass ich das mit dem Super Seven verschieben muss. Mit Claus nicht direkt eine gemeinsame Wellenlänge zu finden, stelle ich mir echt schwierig vor. Noch bevor ich den ersten Schritt in seinen Laden gemacht hatte, waren wir uns über Autos, Camping und die sich hieraus ergebenden Zugeständnisse ans Weibchen völlig einig. Common ground, sehr gut.
Im Laden ging das dann genau so weiter. Innen größer als von außen zu erahnen, gibt es vier Hörräume, verbunden durch die Küche als kommunikative Kommandozentrale. Sehr erleichtert war ich, dass Claus' HiFi-Studio so ziemlich das sympathische Gegenteil des HiFi-Ladens in der Frankfurter Innenstadt ist, der der Prototyp meiner Händlerphobie war.
Dort, unweit der Zeil, steht namhaftes Gerät chromblitzend in Reih und Glied, aber statt Musik hören zu können, hatte ich immer den Eindruck, von den Lautsprechern angeschriehen zu werden.
Ganz anders beim Claus. Hier ist "music in the air" bzw. Musik im Raum. Zwar nicht in Essen, aber Claus hatte wohl mal was mit Musik im Raum Wiesbaden zu tun... Genaueres werde ich bei meinem Folgebesuch unauffällig erfragen. Wer "Fischbrötchen" ist, weiß ich aber schon...
>>((()))°>
Sauleckeren Fisch gibt es übrigens in der japanischen Darreichungsform (Sushi) nebenan beim Claus.
Man könnte direkt dort einziehen 😀
Schöne Grüße und auf ganz bald, lieber Claus!
Steffen