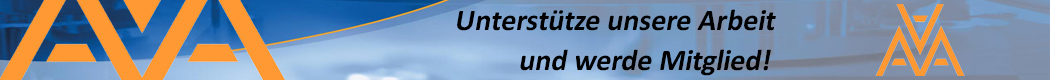Das mit der Dämpfung ist für mich der Grund für den Antrieb mittels Riemen, ich “traue“ den Direktangetriebenen bei der Ruckeldämpfung nicht. Mag für eine Waschmaschine und eine Kornmühle in der Küche taugen, aber für mich kommt ein DD zum Plattenabhören nicht in Frage. Ist rein mental getrieben. Aber die Billigansteuerung mit Synchronmotor und 1:1 die / eine Netzfrequenz von einem Externen Netzteil zu nutzen, ohne eine Information zur echten Drehzahl des Plattentellers, war bis in die 1970er noch gut, aber aktuell sollten da Regelsysteme greifen, einfach schon, um nach einem Austausch des Riemens wieder sicher die Drehzahl zu erreichen.
Einen Rundriemen, der nicht zumindest mit dem Pully geführt wird, muss mit der Zeit wandern, aber eine Rille am Plattenteller außen, das muss schon gut gemacht sein, damit es mir gefällt.
Aber auch da sehe ich eher einen Innenteller, so dass der Außenteller den Riemen vor Staub und anderen Anhaftungen schützt im Vorteil, ich benötige keine freistehenden Motordosen.
Das ist aber mit dem Innen- und Außenteller ist eben auch teuer, denn es müssen Innen und Außenteller präzise zueinander gefertigt werden.
Das heute im „HighEnd“ genutzte System mit der Töpferscheibe und der separaten Motordose und Synchronmotor ist die einfachste Umsetzung und entsprechend billig und ich finde es in Bezug zum Ansehen auch meistens nur häßlich gelöst.
Auch das Thema einen Riemen dann nicht als Flachriemen auszuführen ist erst damit wirklich aufgekommen, ich fürchte ja, dass auch ein Rundriemen deutlich billiger ist, als ein präzise geschliffener Flachriemen.
Man sieht den Antrieb halt offen und es ist dann das Design deutlich relevant und dann kam damit natürlich der Hype um Materialien und Ausführung, dass ein Rundriemen aber deutlich Einfluss auf den Antrieb des Tellers haben kann - insbesondere bei der Umsetzung ohne Nuten - ist ja klar, denn da muss die Spannung zur Haftung passen, ich gehe davon aus, dass hier ausschließlich Silikon und ähnlich gut anhaftende synthetische Materialien genutzt werden, echtes Gummi altert zu schnell und rutscht auch schnell durch und ab.