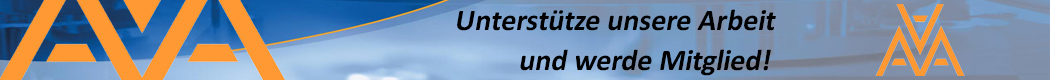Beim Menschen beträgt die Speicherzeit für kleine Klang-Nuancen oder geringe Lautstärke-Änderungen ca. 4 Sekunden. Danach wird dieser Speicherbereich mit neuen Informationen überschrieben.
Wesentlich gröbere Änderungen bleiben etwas länger erhalten und massive Unterschiede, wie z.B. ein ganzes Lied können auch schon mal im Langzeitgedächtnis verbleiben.
Wer glaubt, dass Tuning von elektrischen Geräten (wozu auch Lautsprecher zählen) ähnliche Ergebnisse wie das Autotuning (mit mehr PS, härteres Fahrwerk etc.) bringt, der irrt gewaltig. Der Austausch von (nicht defekten!) Bauteilen gegen erheblich teurere spezielle High-End Bauteile mit gleichen elektrischen Werten bringt keine massive Verbesserung, eventuell sogar eine Verschlechterung (z.B. wenn Elkos gegen Folien-Kondensatoren getauscht werden).
Besser als zu modifizieren ist es, das entsprechende Teil zu verkaufen und sich nach etwas umzuschauen, das für die nächsten Jahre mehr Spaß macht.