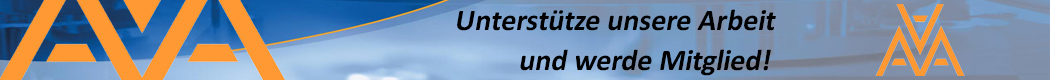Ein kleiner Amp, den es eigentlich nicht geben darf, weil er möglich macht, was nicht möglich sein kann
STC_MkII_3D_640.jpg
Hier geht es zur Homepage.
Sie bekommen den aufgebauten, im Labor durchmessenen und probegehörten Verstärker zum Bausatzpreis.
Die Geschichte "hinter" dem STC-Prinzip
In den späten 90er Jahren kreierte der Japaner Shin-ichi Kamijo eine spezielle Schaltungstechnik, die es ermöglichte, den rauen Klang einer Pentoden-Endstufen dem einer weich klingenden Trioden-Endstufe anzunähern.
Dies wurde ermöglicht, indem er eine Art "nicht lineare lokale" Gegenkopplung vor dem Ausgangsübertrager einführte, die einen geringen Teil der modulierten Anodenspannung der Leistungs-Pentode auf die Anode (!) der vorgeschalteten Verstärkertriode rückkoppelte.
Dieser Schaltungskniff bewirkt hauptsächlich folgendes:
1.: Die Triode "sieht" jetzt den Fehler der Pentode mit all ihren nicht harmonischen Verzerrungen und "krummen" Frequenzgang. Dieser Fehler wird dem Pentoden-Audiosignal zugemischt. Durch die 180° Phasendrehung der invertierend arbeitenden Leistungsendstufe heben sich diese Verzerrungen nahezu auf, und auch der Frequenzgang wird begradigt. Man kann sagen, die Triode "kontrolliert" quasi die Leistungs-Endstufe.
2.: Da diese lokale Gegenkopplung an der Anode und nicht an dem Gitter angeschlossen ist, "bemerkt" die Triode von ihren eigens erzeugten (harmonischen) Verzerrungen nichts und addiert diese ebenso zu dem Audiosignal. Dies ergibt dann den wohlbekannten Trioden-Sound.
Aber warum nicht diesen Schaltungskniff auch bei einem Halbleiter-Endverstärker anwenden?
Das Ergebnis ist absolut verblüffend: Die Endstufe ist in ihrer Halbleiter-Charakteristik nicht mehr hörbar, da deren Fehler eliminiert werden; nur noch der warme Sound der Triode ist present und nichts weiter!
Es ist wirklich kein Vergleich zu den landauf / landab angebotenen Hybrid-Verstärkern, bei denen die Halbleiter-Endstufe ohne jegliche "Röhren-Kontrolle" vor sich hinwerkelt. Da bei diesen "0815"-Verstärkern dem Audiosignal nur die (harmonischen) Verzerrungen der Vorstufen-Triode, nicht aber die Fehler der Endstufe hinzugemischt werden, sind letztere auch an den Lautsprechern present – und hörbar.
Alles verstanden? Mit Sicherheit nicht ![]()
Deshalb begeben wir uns mal ins Mittelalter zurück... (Im Film „Ben Hur“ von Warner Bros. Entertainment, aus dem die Screenshots kommen, sogar bis knapp nach Christi Geburt – bitte das Ganze jetzt nicht so wörtlich nehmen, es dient wirklich nur zur Anschauung.
STC1.jpg
„Schweiß rinnt über die Rücken. Die Sklaven auf den Ruderbänken stöhnen. Sie drücken die Riemen nach vorn. Die Ruderblätter gleiten auf das Wasser herab, tauchen ein. Dann lassen die Männer ihren Oberkörper nach hinten fallen und reißen die Riemen wieder zu sich heran. Dabei ziehen sie die Ruder aus dem Wasser. Ohne Pause stemmen die ausgemergelten Gestalten die Riemen erneut nach vorn. Alle schuften in einem Takt, arbeiten wie eine Maschine. Paukenschläge geben den Takt vor. Wer das Tempo nicht halten kann, bekommt die Peitsche zu spüren. Die Aufseher dreschen mit voller Kraft auf die nackten Rücken ein.“
(aus der Zeit Online: http://www.zeit.de/2010/26/Seefahrt-Galeerensklaven).
Tatsächlich kann man das STC-Prinzip sehr bildlich mit einer Ruder-Galeere vergleichen:
STC2.jpg
Der Konsul ist unser Eingangssignal, hier wird die Marschrichtung vorgegeben
STC3.jpg
Die Sklaven an den Rudern, das ist unsere Halbleiterendstufe
Der Trommler an der Pauke, das ist unser Triodenteil
Dass der Trommler, der den Rudertakt nach Ansage vom Konsul vorgibt, auch Lautstärke- und Geschwindigkeitsschwankungen hat oder eine gewisse „Entscheidungsfreiheit“, merken der Aufseher mit der Peitsche und der Konsul nicht, Hauptsache es geht wie gewünscht voran. Aber genau diese "Ungenauigkeit" ist es, welche den angenehmen und harmonischen K2-Klirrfaktor, typisch für eine Röhre, erzeugt.
STC5.jpg
Die Aufseher merken aber sehr wohl, wenn die Ruderer nicht mehr hinterherkommen und man mit der Peitsche „nachhelfen“ muss, damit schneller gearbeitet wird, das ist der „STC-Teil“ der Röhre.
STC6.jpg
Die Röhre vergleicht das von Halbleiter-Endstufen-Ausgang rückgekoppelte mit seinem eigenen erzeugten am Endstufen-Eingang, „vergisst“ aber dabei die eigenen produzierten Fehler und deren Korrektur. Es verbleibt somit ein Regelsignal, welches ausschließlich die Abweichungen zwischen Eingang und Ausgang der Halbleiter-Endstufe darstellt - abzüglich es eigenen produzierten Fehlers (K2-Klirrfaktor). Und da i.d.R. die Halbleiter-Endstufe nicht so schnell wie eine Röhre in der Anstiegsgeschwindigkeit am Ausgang ist, gibt es halt was mit der Peitsche, damit die Endtransistoren mal „in die Pötte“ kommen.
Dem Endstufen-Eingangssignal werden „Peitschen-Hiebe“ in Form von Nadelimpulsen zugemischt um die Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangssignals dem des Einganssignals anzunähern. Es ist fast unglaublich, diesen Effekt mit einem eingespeisten Rechtecksignal zu sehen; und wer es zum ersten mal auf einem Oszi dargestellt hat, glaubt eher an einen Messfehler. Das Ausgangssignal für den Lautsprecher sieht wirklich fast schon „zu perfekt“ aus; und schaltet man die STC-Korrektur einmal aus, sieht man doch, dass die Endstufe „lahmer“ ist und die Flanken des Rechtecks flacher sind. Nicht nur aus diesem Grund kommt so eine STC-Endstufe klanglich unglaublich dynamisch und „schnell“ daher. Aber eine solche „Signal-Behandlung“ hat auch (gerne verschwiegene) Nachteile: Diese Nadeln verbrauchen ja auch Energie aus dem Netzteil und was ist, wenn das Netzteil nichts mehr liefern kann, sprich „Kraft der Ruderer am Ende trotz Peitschen-Hiebe“?
Dann sieht es so aus wie im Film:
Die Ruderer brechen zusammen, weil sie nicht mehr können und das ganze Gefilde kommt vollständig aus dem Takt.
Übertragen auf die Endstufe heißt das, die Schwingneigung und vor allem der Klirrfaktor nimmt drastisch zu - und zwar wesentlich schlimmer - als bei einer normalen Transistor-Endstufe, wenn man die STC dauerhaft ins Clippen fährt.
Unterm Strich bedeutet das:
1.: Wir brauchen wir ein Netzteil, welches die Nadelimpulse auch liefern kann, d.h. extreme hohe kurze Stromspitzen – das ist mit herkömmlichen Elkos durch ihre interne Induktivität nicht zu erreichen, es müssen LowESR oder sogar Polymer-Typen sein.
2.: Weiterhin muss die Endstufe solche Stromspitzen auch verarbeiten können - und da wird es bei den üblichen Endstufen schon knapp, denn i.d.R. bringen die Treiber der Endstufentransistoren nicht den hohen Strom auf, um die Endtransistoren – und bei mehreren Transistoren parallel das kommt da einiger Strom zusammen – extrem schnell umladen zu können.
Zusätzlich muss man Sorge tragen, dass man die Endstufe nicht zu lang in das oben erwähnte Clippen fährt, um klanglich hörbare Nachteile auszuschließen. Dazu ist es aber notwendig, nicht den Halbleiter-Endstufen-Eingang "abzuriegeln", denn dann wird das Ganze ja noch viel schlimmer, sondern den NF-Eingang der vorgsechalteten Triode.
Hat man das Ganze aber einmal im Griff, so bekommt man als Ergebnis eine Endstufe, die wirklich voll nach Röhre klingt ohne den "Hauch" von Silizium und – dank der niederohmigen Halbleiter – auch genügend Leistung ohne hohe Betriebsspannungen und Ausgangsübertrager anbieten kann.
Gleichzeitig sinken auch die Folgekosten im Betrieb durch die doch sehr kurze Lebensdauer der bei einem reienen Röhrenkonzept ausgepowerten Endstufenröhren. Die Triode in der Vorstufe wird indes weit unter ihren Maximalwerten betrieben und hat dadurch nahezu das "ewige Leben". Und eine ewig dauernde Freundschaft mit dem Stromlieferanten kommt nebenbei mit den Transistoren in der Endstufe auch nicht zustande.
Man sieht aber auch einmal, wie "laut" die max. 18 Watt aus dem kleinem STC-Verstärker sein können. Man glaubt es schlicht und ergreifend nicht, dass das bloß "so wenig" ist.
Natürlich, das Ohr will auch befriedigt werden, und wenn der STC schon bei geringeren Lautstärken ungeheuer dynamisch ist, braucht man die extrem hohen Lautstärken gar nicht mehr, denn es "fühlt" sich einfach lauter an.
Im Nachgang muss man natürlich auch sagen, dass das STC-Prinzip keine Wunder verbringen mag. Eine schlecht klingende Endstufe wird mit "STC-Korrektur" niemals zu Höchstform auflaufen, allerhöchstens noch zu einem HF-Oszillator. Die Endstufe muss auch "mit ohne" schon sauber klingen und absolut stabil laufen - auch zu hohen Frequenzen hin. Dann setzt ihr das STC-Prinzip das richtig schmackhafte Sahnehäubchen auf.